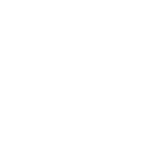Der Weg in die Abhängigkeit
Es fängt alles so harmlos an.
Dann und wann wird gefeiert - natürlich mit Alkohol.
Abends das Gläschen zur Entspannung.
Anfangs ist der Griff zum (späteren) Suchtmittel ein Erfolg; der spätere Abhängige erlebt eine bisher nie gekannte Erleichterung. Es funktioniert auf einmal alles. Der Betroffene merkt auf einmal, dass es ihm wesentlich besser geht, wenn er Alkohol getrunken hat. Er kann besser schlafen, besser reden, er fühlt sich stärker und mutiger, die Sorgen und die Einsamkeit belasten ihn nicht mehr so stark. Eine Flucht in die "heile Welt" der Problemlöser, wie z. B. Alkohol, ist immer eine Flucht vor sich selbst.
Jede Situation, ob Ärger oder Freude, wird Anlass zum Trinken.
Der Alkohol ist jetzt für ihn kein Getränk mehr, sondern ein hilfreiches "Medikament".
Wer gelernt hat, Stimmungen und Gefühle mit Hilfe des Suchtmittels zu steuern, gerät leicht in Versuchung, dies häufiger zu tun.
Der positive Effekt verfliegt allerdings in der Folgezeit immer schneller. Die Fähigkeit, auf persönliche Schwierigkeiten angemessen zu reagieren, nimmt weiter ab. Der Wunsch, das Mittel zu konsumieren wird so stark, dass es immer häufiger missbraucht wird, immer noch in der trügerischen Hoffnung, einen bestimmten Gefühlszustand zu erreichen. Schließlich wird der Versuch, durch eine weiter steigende Dosis des Suchtmittels eine bessere Wirkung zu erreichen, zum Verhängnis.
Seelische Abhängigkeit entsteht, das Suchtmittel wird zum Dreh- und Angelpunkt aller Handlungen, Gedanken und Gefühle.
Die Sucht hat die ursächlichen Probleme überlagert und neue geschaffen!
***
Man unterscheidet zwischen Genuss, Missbrauch, Gewöhnung und Abhängigkeit.
Viele Menschen haben ihren Konsum unter Kontrolle und kennen ihre Grenzen.
Der Missbrauch von Alkohol geht über den Genuss hinaus und kann durch zunehmende Gewöhnung ein Übergangsstadium zu einem abhängigen Verhalten sein.
Von Missbrauch spricht man, wenn
- man Suchtmittel konsumiert, um unangenehme Gefühle (z. B. Angst, Unruhe, Langeweile usw.) wegzumachen,
- man Alkohol konsumiert, wenn es nicht angebracht ist (z. B. beim Autofahren, am Arbeitsplatz usw.),
- man immer wieder Alkohol zu sich nimmt, obwohl man begriffen hat, dass dadurch negative Folgen für den Körper, den psychischen Zustand, die finanzielle Situation oder andere Personen (z. B. aggressives Verhalten) entstehen.
Der Übergang von Missbrauch zur Abhängigkeit ist fließend.
Menschen, die sich nüchtern in bestimmten Situationen unsicher und hilflos fühlen, da sie nicht über ausreichende Bewältigungs- oder Konfliktlösestrategien verfügen, können schnell in eine Abhängigkeit geraten.
Typische Kennzeichen von Alkoholsucht:
- Zwang zu trinken. Getrunken wird nicht mehr zum Genuss, sondern aus einem inneren Zwang. Ein nahezu unbezwingbares Verlangen nach dem nächsten Schluck, das ständige Denken an Alkohol.
- Abstinenzunfähigkeit. Alkoholiker scheitern regelmäßig beim Versuch, mit dem Trinken aufzuhören. Dennoch sind alkoholkranke Menschen überzeugt, dass sie jederzeit aufhören könnten! Oft gelingt es ihnen sogar über Tage und Wochen und bestärkt sie damit in ihrem Glauben, nicht abhängig zu sein. Doch sobald sie wieder zum Glas greifen, ist der nächste Rückfall vorprogrammiert. Ihr Scheitern erhöht ihre Frustration und lässt sie erst recht weitertrinken. Das geht so weit, dass der alkoholkranke Mensch selbst dann nicht auf Alkohol verzichten kann, wenn die Sucht bereits schwere gesundheitliche oder soziale Konsequenzen hat.
- Toleranzbildung. Menschen, die in eine Sucht geraten, müssen immer mehr trinken, um einen Effekt zu erzielen. Der Körper gewöhnt sich an das Suchtmittel, der Konsum steigt. Der Betroffene kann deutlich mehr vertragen, als Menschen mit normalem Konsum.
- Exzessives, mitunter tagelanges Trinken, das zu Erinnerungslücken führt.
- Kontrollverlust. Ein Alkoholiker ist kaum in der Lage zu kontrollieren, wann er trinkt bzw. wann er mit dem Trinken aufhört und wie viel Alkohol er konsumiert. Solange er nicht auffällig wird, wirkt alles normal und die Umwelt akzeptiert ihn. Wenn der Konsum aber zunimmt, sein Verhalten sich störend verändert, dann treten Schwierigkeiten mit der Familie, Freunden und dem Arbeitgeber auf.
- Entzugserscheinungen. Wird bei körperlicher Abhängigkeit weniger oder gar kein Alkohol getrunken, zeigen sich heftige Entzugserscheinungen. Sie reichen von verhältnismäßig leichten Symptomen wie Schweißausbrüche, Frieren, Händezittern, Gliederschmerzen und Schlafstörungen bis hin zu Halluzinationen, Angstzuständen, depressiven Stimmungen, Konzentrationsstörungen, Kreislaufzusammenbrüchen oder zu Krampfanfällen, die sogar zum Tode führen können. Nur eine neue Dosis Alkohol kann dann die Entzugserscheinungen lindern, so dass der Teufelskreis nur schwer unterbrochen werden kann.
- Rückzug aus dem Sozialleben. Wer in einer Sucht gefangen ist, verliert das Interesse an anderen Beschäftigungen oder Aufgaben. Hobbys, soziale Kontakte und selbst der Beruf werden vernachlässigt. Familie und Freunde treten immer weiter in den Hintergrund. Die Droge Alkohol wird zum Lebensmittelpunkt. Über 90 % seiner Zeit verbringt der Abhängige mit Besorgung, Konsumierung und Entsorgung des Suchtmittels.
- Heimlichkeit und Schuldgefühle. Trotz offensichtlicher Probleme weisen die meisten Alkoholiker es weit von sich, ein Alkoholproblem zu haben ("Ich bin doch kein Penner"). Er gibt sich nach außen stark, obwohl er sich innerlich ohnmächtig, hilflos, schwach und wertlos vorkommt. Das vergebliche Bemühen, vom Alkohol loszukommen, führt ihn in tiefe seelische Not, in Angst, in Verzweifelung und Depressionen. Er wird von heftigen Selbstvorwürfen, von Scham- und Schuldgefühlen gequält. Vor seinem Umfeld versucht er, dies mit allen Mittteln zu verbergen. Der Alkoholiker trinkt heimlich, legt sich Alkoholvorräte an und versteckt sein Suchtmittel, um nicht aufzufallen.
Keiner dieser Aspekte allein macht eine Abhängigkeit aus.
Abhängigkeit setzt sich aus vielen verschiedenen Faktoren zusammen und kann individuell sehr unterschiedlich aussehen.
***
Jeder kann suchtkrank werden, auch wenn viele denken: "Mir kann das nicht passieren". Es gibt dafür keine Garantie! Wer zur Bewältigung seiner sozialen oder familiären Lebenssituation, zur Problemlösung oder zur "Verbesserung" seines Lebensgefühls zu Suchtmitteln greift, ist suchtgefährdet.
Alkoholabhängigkeit ist eine Krankheit und keine Willensschwäche!
Die Betroffenen kommen aus allen Gesellschaftsschichten: Selbststände, Angestellte, Arbeiter, Ingenieure, Lehrer, Priester, Ärzte, Politiker usw., wobei das Durchschnittsalter der Suchtkranken immer geringer wird. Es betrifft Männer wie Frauen.
***
Der Weg in die Alkoholsucht ist langsam und schleichend. Die Krankheit kann sich über viele Jahre hinweg ziehen. 15 bis 20 Jahre sind keine Seltenheit.
Aus den Klauen dieser Abhängigkeit kann sich der Kranke mit eigenem Willen nicht mehr befreien.
Er braucht fachliche Hilfe!
Die Fähigkeit, mit dem Alkohol wieder normal umzugehen, ist verloren und wird niemals wiedererlangt.
Ein Abhängigkeitskranker, der nichts gegen seine Krankheit unternimmt, begeht Selbstmord auf Raten.
Wie man diesen Teufelskreis verlassen kann, erfahren Sie unter